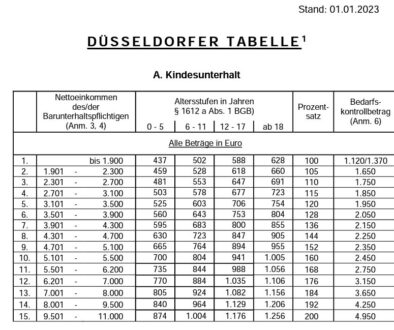Umgangsrecht – Was tun, wenn alles geregelt ist, aber das Kind nicht will?
Die stellt das betroffene Elternteil oft vor große Herausforderungen.
Es gibt verschiedene Optionen, wie Sie in dieser Situation vorgehen können – stets mit dem Ziel, das Kindeswohl in den Mittelpunkt zu stellen und juristische Vorgaben zu beachten.
1. Gespräch mit dem Kind suchen
-
Ruhig und verständnisvoll nach den Gründen fragen, ohne Druck aufzubauen.
-
Altersangemessene Gespräche führen und die Gefühle des Kindes ernst nehmen.
-
Dabei idealerweise keine negativen Äußerungen über den anderen Elternteil machen, um Loyalitätskonflikte zu vermeiden.
2. Beide Elternteile einbeziehen
-
Wenn möglich, sollte man versuchen, gemeinsam eine Lösung zu finden, ggf. mit Unterstützung einer neutralen dritten Person.
-
Mitunter kann ein gemeinsames Gespräch helfen, Missverständnisse zu klären.
3. Jugendamt einschalten
-
Kommt man so nicht weiter, macht es ggf. Sinn, das örtliche Jugendamt zu kontaktieren. Es bietet Beratung und Vermittlungsgespräche an.
-
Dort kann auch eine Umgangsberatung in Anspruch genommen werden.
-
Das Jugendamt versucht, eine Lösung im Sinne des Kindes zu unterstützen, ohne gleich eine (erneute) Eskalation vor Gericht zu schaffen.
4. Beratungsstellen und Familienberatung
-
Auch professionelle Familienberatungen oder Erziehungsberatungsstellen vermitteln zwischen Kind und Elternteil.
-
Sie können dabei helfen, Ursachen herauszufinden und Lösungen zu erarbeiten.
5. Gerichtliche Regelung: Abänderungsantrag oder Umgangspflegschaft
-
Wenn sich die Situation verfestigt, kann beim Familiengericht ein Antrag auf Änderung der Umgangsregelung gestellt werden (das ist dann ein sogenannter Abänderungsantrag).
-
Bei schweren Konflikten kann das Gericht eine sogenannte Umgangspflegschaft anordnen: Eine neutrale Umgangsperson begleitet und organisiert den Kontakt.
-
In besonders gelagerten Ausnahmefällen kann das Gericht den Umgang auch aussetzen oder einschränken, wenn dies dem Kindeswohl entspricht. Es kann im Einzelfall dazu kommen, daß das Ergebnis dann keinem Elternteil und auch dem Kind nicht gefällt.
Das Gericht hat nur das Kindeswohl im Auge.
6. Pflicht zur Förderung des Umgangs
-
Der betreuende Elternteil ist gerichtlich verpflichtet, den Umgang mit des Kindes mit dem anderen Elternteil zu fördern und das Kind zu unterstützen.
-
Aber: Niemand darf das Kind zwingen oder psychischen Druck ausüben. Körperlicher Zwang ist verboten.
-
Lehnt das Kind den Umgang dauerhaft und aus eigenem Antrieb ab, kann dies in besonderen Fällen zu einer gerichtlichen Neubewertung führen.
7. Dokumentation
-
Dokumentieren Sie die Situation (Gespräche, Termine, Verhalten des Kindes), um bei Bedarf nachweisen zu können, wie Sie den Umgang gefördert und unterstützt haben.
Zu beachten:
-
Kinder werden mit zunehmendem Alter und Reife bei gerichtlichen Entscheidungen stärker angehört (ab ca. 10-12 Jahre wird der Kindeswille erheblich berücksichtigt).
-
Das Kindeswohl ist oberste Richtschnur; Gerichte wägen zwischen dem Recht auf Umgang und dem Wohl des Kindes ab.
-
Bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung (z.B. Gewalt, Missbrauch) ist umgehend das Jugendamt und ggf. das Familiengericht informieren!
Zusammenfassung:
Das bloße Verweigern des Umgangs durch das Kind entbindet nicht automatisch von der Pflicht zur Ermöglichung des Umgangs.
Wichtig sind ein besonnenes Vorgehen, das Einbinden professioneller Hilfe und die genaue Beachtung rechtlicher Vorgaben durch beide Elternteile.
Im Zweifelsfall empfiehlt sich immer die Rücksprache mit einer Anwältin oder einem Anwalt für Familienrecht.
Bild: Adobe Firefly KI